Franz Lennartz
Ausstellung in der Frankfurter Universitätsbibliothek vom 1. März - 31. März 2010
| Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 3. Obergeschoss 60325 Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße 134-138 U4, U6, U7 (Station «Bockenheimer Warte») Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9.00 Uhr - 19.00 Uhr Samstag und Sonntag geschlossen |
 |
|
Franz Lennartz wurde am 20. März 1910 als Sohn eines Kaufmanns im rheinischen Rheydt geboren und wuchs dort als jüngstes von fünf Kindern auf. Nach dem Abitur (1929) studierte er in Bonn, Köln und Berlin Germanistik, Philosophie und Geschichte. Schon früh trat er als Autor, Feuilletonist und Literaturkritiker hervor und schrieb für Zeitungen und Zeitschriften. In Berlin lernte er seine Frau Gudrun, geb. Dux kennen (Heirat 1935) und arbeitete als Lektor für Rundfunk und Film (Universum Film, UFA).
Bereits früh interessierte Lennartz sich für die zeitgenössische Literatur, sammelte Material, korrespondierte mit Autoren und verfasste Darstellungen zu ihrem Leben und Werk. Sein Band Dichter unserer Zeit. 275 Einzeldarstellungen zur deutschen Dichtung der Gegenwart (1938) wurde als »Literaturführer für jedermann« mehrfach aufgelegt und erweitert. Während des Zweiten Weltkriegs war er als Offizier zuletzt in Breslau stationiert und geriet dort 1945 in sowjetische Gefangenschaft, aus der er erst fünf Jahre später zurückkehrte. Fortan widmete er sich ganz der Weiterarbeit an seinen Autorenlexika Deutsche Dichter und Schriftsteller unserer Zeit (elf Auflagen) und Ausländische Dichter und Schriftsteller unserer Zeit (fünf Auflagen), die, jeweils gründlich überarbeitet, bald zum Standardnachschlagewerk der literarisch Interessierten und zu den meist gelesenen Literaturlexika im deutschsprachigen Raum gehörten. In seinen Darstellungen behandelt Lennartz, ein Meister der knappen Charakteristik, die Autoren und Werke nicht im Sinne der fachwissenschaftlichen Darstellung, sondern er beleuchtet sie feuilletonistisch und sprachlich vielschichtig in essayistischen Kabinettstückchen, zeigt sie im Spiegel der Kritik und Kontext ihrer Epoche. Biografische und bibliografische Details recherchierte er mit großer Sorgfalt, was Marcel Reich-Ranicki veranlasste, vom »Lennartz« als dem »zuverlässigen Lexikon« zu sprechen, und Uwe Johnson befand: »alles ist da«.
 |
| Franz Lennartz (rechts) als Kind in Rheydt |
| |
Lennartz zog 1960 von Berlin nach Kirchhofen bei Freiburg und von dort 1967 nach Salem am Bodensee. Enge Freundschaften verbanden ihn mit dem Literaturwissenschaftler Bruno Hillebrand (Mainz) und der Schweizer Dichter Dino Larese (Amriswil). 1987 erwarb das Deutsche Literaturarchiv des Schiller-Nationalmuseums den Briefwechsel von Franz Lennartz mit den von ihm behandelten deutschsprachigen Autoren, ca. 1.700 Korrespondenzen (unter Anderem mit Robert Musil, Franz Kafka, Ernst Jünger, Gerhart Hauptmann, Gottfried Benn, Paul Celan, Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Carl Zuckmayer). Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit pflegte er sein über Jahrzehnte gewachsenes Archiv zur Literatur und zu Themen der Zeitgeschichte (Sondersammlungen u.a. zu Goethe, Napoleon, Picasso), sammelte neben Tausenden Büchern ein nahezu unüberschaubares Konvolut an Artikeln, Notizen, Rezensionen und Beiträgen deutschsprachiger und internationaler Publikationen. Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG), der Hessischen Kulturstiftung für Wissenschaft und Kunst und des S. Fischer Verlages erwarb die Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 1990 komplett diesen wichtigen Teil seines Lebenswerkes, der heute Teil des dortigen Archivzentrums ist (Sammlung Franz Lennartz zur deutschen Literatur) ist.
Der Fundus umfasst rund 900 Meter, etwa drei Viertel davon sind wissenschaftlich, z.B. über eine im Internet einsehbare Autorenliste, erschlossen. Neben den Zeitungsausschnitten und Materialsammlungen zu einzelnen Schriftstellern und Epochen umfasst das Frankfurter Franz-Lennartz-Archiv auch seine eigenen Manuskripte, Briefwechsel, Bücher, Sonderdrucke sowie Werbematerialen von Verlagen. Beachtlich ist die Sammlung der Widmungsbücher, mit den Autographen der Schriftsteller Bertolt Brecht, Marie Luise Kaschnitz, Wolfgang Köppen, Hanns-Josef Ortheil, Anna Seghers, Fritz Usinger und vielen anderen, die wir heute allenfalls noch im Internet recherchieren können. Weiterhin sind die Briefe ausländischer Schriftsteller in Frankfurt erhalten, mit denen sie auf ihre Darstellung in den Lexika reagierten und Vorschläge machten. Zufrieden waren sie durchaus nicht alle, auch die ausländischen Dichter nicht, Francois Mauriac hielt den ihn betreffenden Artikel allerdings für »tout à fait correcte«, T.S Eliot schrieb »there is nothing in the article to which I object« und W.S. Maugham korrigierte nur »I didn't study medicine at Oxford but at St.Thomas's Hospital London«. Kaum noch nachvollziehbar scheint heute, dass manche Autoren nach dem zweiten Weltkrieg zwar ihre Bücher schickten, um in Werke von Franz Lennartz aufgenommen zu werden, dass sie aber darum baten, diese »nach Gebrauch« wieder zurückzuschicken, so rar waren Bücher in der Nachkriegszeit.
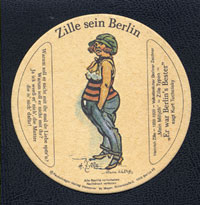 |
| Auch Kuriosa zur Literatur gehören zur Sammlung |
| |
Franz Lennartz veröffentlichte seine Lexika im Verlag Alfred Kröner Stuttgart. In einem Interview der ZDF-Sendung »Aspekte« wurde 1985 die Auflage seiner Bücher mit 270.000 Exemplaren angegeben, ein respektables Ergebnis, da es sich hier um Nachschlagewerke bzw. Sachliteratur handelt. Anders als der »universitäre« Lexikograph Gero von Wilpert, der ebenfalls bei Kröner publizierte, arbeitete Lennartz journalistisch auf der Basis seines sich ständig erweiternden Archivs, das in aus Tapeten geschnittenen Mappen, Gurkenschachteln und Bananenkisten geordnet wurde. Das Haus in Salem-Beuren wurde im Blick auf die immensen Sammlungen statisch stärker konstruiert.
 |
| Der kritische Blick auf die Dichter, um 1990 |
| |
Auch in der Bundesrepublik blieb »Lennartz« nicht ohne Kritik, wenn sie auch nicht unbedingt aus der Richtung kam, wie man sie heute aus retrospektiver Sicht erwartete. So schrieb ein Kritiker, schon beim oberflächlichen Durchblättern sehe man, dass die Auswahl der Schriftsteller »recht einseitig« ist. Jedenfalls falle einem auf, dass beispielsweise die sudetendeutschen und südostdeutschen Autoren fehlen, und es sei doch heute allgemein bekannt, dass die stärksten Gegenkräfte gegen die so gefürchtete Bolschewisierung nicht in der Asphaltliteratur, sondern gerade in der heimatverbundenen Dichtung zu finden sind. Die sog. 68er Generation hingegen fand bei Lennartz mehrheitlich Konservatives und »Rechtes«. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Lennartz 1969 nicht nur Gerhard Zwerenz, sondern neun Jahre später auch Franz-Josef Degenhard mit einem ausführlichen Artikel als Schriftsteller aufnahm, wobei sich seine Darstellung nicht nur auf den Roman »Zündschnüre«, sondern vor allem auch auf seine poetisch-hintergründigen Liedtexte bezieht.
Wenig bekannt ist, dass Franz Lennartz sich auch als Romancier versuchte, allerdings wurden seine wenigen Manuskripte niemals gedruckt. Eines davon war der Roman »Mädchen in der Etappe«, vorwiegend handelnd von Wehrmachtshelferinnen und ihren Offizieren im ausgehenden zweiten Weltkrieg. Lennartz selbst schrieb darüber: Es ist vor allem der Roman einer jungen Bürgerstochter, die, wie ungezählte Mädchen ihrer unglücklichen »Generation ohne Beispiel«, als Wehrmachtshelferin in die Kaserne eingezogen, dort verführt, gedemütigt, irregeführt und schließlich zur Revolte gegen die ausschließlich männlich bestimmte Welt gezwungen wird. Sie wird ebenso um ihre Jugend betrogen. Dieses Buch, das »irgendwo in Deutschland« spielt, ist kein Schlüsselroman. In ihm ist eine überpersönliche Welt gestaltet, so, wie sie »ist, nicht aber, wie mancher sie sich wünscht«.
 |
| Ausstellungseröffnung 1995 |
| |
 |
| Franz Lennartz mit Frau Gudrun um 1990 |
| |
Die Universitätsbibliothek Frankfurt ehrt ihn, fünfzehn Jahre nach der großen Frankfurter Ausstellung im März des Jahres 2010 mit einer kleinen Replik im dritten Stock der Bibliothek:
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 134-138
60325 Frankfurt am Main
Öffnungszeiten der Ausstellung : Mo-Fr 9.00 - 19.00 Uhr
Werke von Franz Lennartz
Die Dichter unserer Zeit. Einzeldarstellungen zur deutschen Dichtung der Gegenwart. Kröners Taschenausgabe Band 217. Stuttgart: Kröner Verlag 1938. 2. Aufl. 1939. 3. Aufl. 1940. 4. Aufl. 1941. 5. Aufl. 1952
Dichter und Schriftsteller unserer Zeit. Einzeldarstellungen zur Schönen Literatur in deutscher Sprache. Kröners Taschenausgabe Band 217. Stuttgart: Kröner Verlag 1954 (6. Aufl.). 7. Aufl. 1957
Deutsche Dichter und Schriftsteller unserer Zeit. Einzeldarstellungen zur Schönen Literatur in deutscher Sprache. Kröners Taschenausgabe Band 217. Stuttgart: Kröner Verlag 1959 (8. erw. Aufl.). 9. erw. Aufl. 1963. 10. erw. Aufl. 1969
Deutsche Schriftsteller der Gegenwart. Einzeldarstellungen zur Schönen Literatur in deutscher Sprache. Kröners Taschenausgabe Band 217. Stuttgart: Kröner Verlag 1978 (11. erw. Aufl.)
Ausländische Dichter und Schriftsteller unserer Zeit. Einzeldarstellungen zur Schönen Literatur in fremden Sprachen. Kröners Taschenausgabe Band 217. Stuttgart: Kröner Verlag 1955. 2. erw. Aufl. 1957. 3. erw. Aufl. 1960. 4. erw. Aufl. 1971 und 1976.
Deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts im Spiegel der Kritik. 845 Einzeldarstellungen mit Werkregister und dokumentarischem Anhang. Mit einem Vorwort von Imma Klemm. 3 Bände in Kass. und Registerband. Stuttgart: Kröner Verlag 1984
Weblink
» http://www.ub.uni-frankfurt.de/archive/lennartz.html
Literatur
Art. Franz Lennartz, in: Internationales Germanistenlexikon 1800 -1950, hrsg. von Christoph König, CDROM - Version, Berlin: de Gruyter, 2003
Rune, Doris: Franz Lennartz' Literaturführer im Dritten Reich und nach 1945: Studien zum Inhalt. - (Maschinenschr. vervielf.) - Stockholm: Universitet, 1969
Schmidt, Wilhelm Richard: Franz-Lennartz-Archiv in Frankfurt am Main. In: Begegnung - Amriswil (1992) H. 23, o. Pag.
Sabine Homilius, Wilhelm R. Schmidt, Franz Lennartz. Zeitgenosse und Sammler, Lexikograph und Feuilletonist. Begleitbuch zur Ausstellung der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, 15. November bis 15. Dezember 1995. Frankfurt 1995
Wilhelm R. Schmidt, Tapetenmappe, Gurkenschachtel und Bananenkiste: Der Lexikograph Franz Lennartz ist tot. In: Uni-Report 36 (2003), 2, S. 11.
Zurück zum Seitenanfang
zuletzt geändert am 15. Oktober 2024